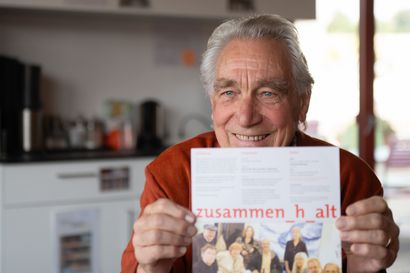Am westlichen Rand des Winterthurer Lagerplatz-Areals entstand mit dem «Zusammen_h_alt» ein pionierhaftes Wohnprojekt, das zeigt, wie Leben im Alter auch aussehen kann. Die Genossenschaft, getragen von ihren Bewohnerinnen und Bewohnern, entwickelte das Haus in enger Partnerschaft mit der Stiftung Abendrot – und schreibt damit an einem zukunftsweisenden Kapitel gemeinschaftlichen Wohnens.
Vom Gespräch zur Genossenschaft
Die Idee entstand Mitte der 2000er-Jahre in einer Winterthurer Männergruppe: In Gesprächen über das Altwerden tauchte der Wunsch auf, eine eigene Form des Wohnens für die Zeit «nach Arbeit und Familie» zu entwickeln. Die Leitplanken: Reduzieren des privaten Wohnraums zugunsten von Gemeinschafts- und Begegnungsorten. Bald stiessen weitere Interessierte dazu. Aus einer losen Gruppe Gleichgesinnter entstand 2008 zunächst ein Verein und 2010 die Genossenschaft Zusammen_h_alt.
Inspiration boten bestehende Projekte wie «Solinsieme» in St. Gallen. Die Gründerinnen und Gründer nahmen sich deren Ratschlag zu Herzen: früh mit der Planung beginnen, wenn man wirklich eine neue, alternative Wohnform entwickeln will. Bald war klar: Das Projekt soll genügend Grösse haben, um Vielfalt unter den Bewohnenden zu ermöglichen.
Die Suche nach einem geeigneten Grundstück erwies sich als Geduldsprobe. Vier Jahre lang suchte die Gruppe ohne Erfolg. Mehrfach stand das Projekt vor dem Aus. «Ich wollte den Bettel sicher sieben Mal hinschmeissen», erinnert sich Mitgründer Peter Hajnoczky. Erst als 2012 Abendrot mit einer Fläche auf dem Lagerplatz auf die Genossenschaft zukam, nahm das Vorhaben konkrete Form an. Für Abendrot, die das Areal seit 2006 Schritt für Schritt ökologisch, gemeinwohlorientiert und nutzungsgemischt entwickelt, war das Projekt ein idealer letzter Baustein: ein Neubau, getragen von einer selbstorganisierten Genossenschaft, für Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Daneben sollte das Gebäude der benachbarten Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) zusätzlichen Raum bieten.
Ein Haus als gemeinsames Vorhaben
Abendrot übernahm die Finanzierung und den Bau. Die Genossenschaft brachte ihre Vision eines «Dorfs im Haus» ein: kleine, flexible Wohnungen und grosse gemeinschaftliche Räume, viel Platz für Begegnung. In Workshops, Retraiten und Versammlungen entstand ein detailliertes Raum- und Nutzungskonzept, das mehr als Wohnen vorsah – eine «soziale Infrastruktur», wie es Abendrot nennt. Dazu zählen 75 Wohnungen unterschiedlicher Grösse, ergänzt durch Bibliothek, Gemeinschaftsküche, Gästezimmer, Plattform, Musikzimmer, Waschsalon, Dachterrassen und vielem mehr. «Das Nebeneinander von gemeinschaftlichem Alterswohnen und Hochschulbetrieb stellte eine planerische Herausforderung dar – und zugleich eine Chance, Vielfalt auf engem Raum zu realisieren.», sagt Tina Puffert, Projektleiterin bei Abendrot.
Nicht alles verlief reibungslos – so wurde zum Beispiel beim ausgelobten Architekturwettbewerb nicht das vom «Zusammen_h_alt» favorisierte Projekt umgesetzt. Die heutige Lösung hat aus deren Sicht Mängel: Die Wohnungs-Grundrisse erwiesen sich als weniger flexibel als gewünscht, was zum Beispiel getrennte Schlafzimmer für Paare erschwert. Auch die räumliche Verteilung der Wohnungen – mit Balkon und Aussicht oben, kleineren Einheiten unten – führte zu Diskussionen. «Wir von der Holzklasse» nennen sich einige Bewohnende der unteren Stockwerke augenzwinkernd. Dennoch überwiegt das Positive: «Emotional haben wir das Gefühl, das Haus gehört uns», sagt Mitgründerin Sabina Poulsen.
Leben in Vielfalt
Heute wohnen 96 Menschen zwischen Anfang 50 und über 80 im Haus. Die Vielfalt ist gross: Berufstätige treffen auf Pensionierte, Ruhesuchende auf Gesellige. Platz hat es für beides. «Ich wollte nicht in einer betreuten Wohnform landen, aber auch nicht allein», erzählt Bewohnerin Sylvia Felix. «Hier bin ich Teil einer Gemeinschaft, ohne meine Unabhängigkeit aufzugeben. Und es ist beruhigend zu wissen, dass jemand hinschaut, wenn man länger nicht aus der Wohnung kommt.»
Für viele war der Einzug ein grosser Schritt: Ein Grossteil der heutigen Bewohnerinnen und Bewohner lebte zuvor in Einfamilienhäusern und hat grosszügigen Wohnraum gegen deutlich kleinere Wohnungen eingetauscht. Dies verlangte Loslassen – bot aber auch die Chance, Neues zu gestalten. «Wir müssen uns im Alter erlauben, unser Leben nochmals neu zu betrachten und zu entwickeln», meint Gründungsmitglied Peter Hajnoczky.
Selbstorganisation als Prinzip
Der «Zusammen_h_alt» ist eine selbstverwaltete Genossenschaft. Das erfordert Strukturen – und Einsatz. Es gibt Arbeitsgruppen für jeden Gemeinschaftsraum, für Veranstaltungen und Hauskultur, dazu Kommissionen für Vermietung, Bau, Gewerbe, Finanzen und Kommunikation. Entscheidungen, die die Genossenschaft betreffen, werden an der Generalversammlung getroffen. Betrifft es die Bewohnerschaft, werden Anliegen in mehreren Stufen beraten: in den Hauseinheiten, im Wohnrat und schliesslich in der Hausversammlung.
«Selbstorganisation ist Arbeit – aber sie schafft auch echte Teilhabe», sagt Carmen Burgos, Co-Präsidentin. Sie moderiert Konflikte, hört Anliegen an und sorgt dafür, dass Themen den richtigen Weg nehmen. «Gemeinschaftliches Wohnen braucht Strukturen. Regeln stellen wir nur auf, wenn wir sie als nötig erachten. Wichtig ist, dass alle Verantwortung übernehmen und aufeinander achten».
Konflikte bleiben nicht aus – vom Putzplan bis zur Frage der Entkalkung des Trinkwassers. Doch Streit wird nicht verdrängt, sondern diskutiert – die Themen wandern vom Chat über Themenforen und schliesslich auf die Traktandenliste des Wohnrats oder des Vorstandes. Am Ende steht ein Beschluss – manchmal nach langen Debatten.
Alltag zwischen Eigeninitiative und Kultur
Das Leben im Haus ist reich an Aktivitäten: Ein eigenes Orchester spielt alle zwei Wochen Hausmusik. Es gibt Lesungen, Workshops, Feste und ein gemeinsames Gartenteam. «Es wird sehr viel Eigenkultur produziert», sagt Hajnoczky.
Auch weniger Gelungenes gehört zur Geschichte: Das Bistro im Erdgeschoss wurde anfangs von der Genossenschaft selbst betrieben – und scheiterte. Erst als die «Stiftung Netzwerk» übernahm, entwickelte es sich zu einem lebendigen Treffpunkt.
Der Einzug 2020 fiel zudem mitten in den Corona-Lockdown. Die Gemeinschaftsräume mussten geschlossen bleiben, die ursprüngliche Idee des Miteinanders konnte nicht gelebt werden. «Das war eine harte Zeit», so Poulsen. Erst später entwickelte sich das, was heute Alltag ist: gegenseitige Unterstützung, vielfältige Aktivitäten und das Bewusstsein, dass man nicht allein ist.
Herausforderungen und Ausblick
Noch ist die Frage offen, wie das Haus mit zunehmender Pflegebedürftigkeit umgehen wird. «Bisher funktioniert alles bestens», sagt Burgos. «Aber die Zeit wird zeigen, welche Lösungen wir brauchen.»
Für Abendrot ist das Projekt ein Modell. «Wir planen möglichst nicht ohne die künftige Nutzerschaft», betont Puffert. «Gerade die frühe Einbindung von Zusammen_h_alt hat sich bewährt – das nehmen wir auch in andere Projekte mit.» Städtebaulich und sozial fügt sich das Haus nahtlos in den Lagerplatz ein. Das Bistro, die Gewerbeflächen und die Nähe zur ZHAW verankern es im Quartier. Kinderkrippe, Quartierladen, Ateliers, Dienstleistungen und Hochschule bringen Jung und Alt, Alltag und Wissenschaft unter ein Dach. So wirkt das Gebäude über sich hinaus – als Lernort, als Treffpunkt, als Inspiration.
Oder wie es Mitgründer Hajnoczky formuliert: «Ich wünsche mir, dass Abendrot aus den gemeinsam gemachten Erfahrungen profitiert und dieses Wissen in weitere Projekte trägt.»
Mehr zum Projekt: Interview mit Tina Puffert, Projektleiterin bei Abendrot
Der Film zum Projekt: Horizonte